Ausgabe 200607
Mag. Peter Sylvester Lehner
Wiener Symphoniker, Geschäftsführer
AMN: Mag. Lehner ist seit ca. einem Jahr mit der Geschäftsführung der Wiener Symphoniker betraut. In diesem Zusammenhang wollen wir mit Mag. Lehner Rückschau halten und natürlich auch den Blick in die Zukunft richten. Die Geschäftsführung eines Orchester ist keine leichte Aufgabe und wird von den Konzertbesuchern sicher nie richtig gewürdigt. Es werden die Stars bewundert die Dirigenten angehimmelt und fallweise über die Leistungen der Orchestermusiker gute oder schlechte Kritiken verteilt. Bis es jedoch dazu kommt, ein fertiges Programm mit all den nötigen Konsequenzen auf die Bühne bzw. aufs Podium zu bringen, ist viel organisatorisches Handeln und Entscheiden gefragt. Diese Hintergrundinformation soll zum besseren Verständnis beitragen, jedes Konzert auch aus der Sicht eines nicht aktiven Musikers - jedoch voll involvierten Akteurs - zu sehen.
AMN: Herr Mag. Lehner, Sie kommen aus der Musikmanagementbranche, haben jahrelang in ähnlicher Funktion gewirkt. Wie kommt man dazu, in diesem Metier Fuß zu fassen?
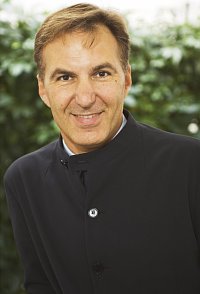 Mag. Lehner:
Ich habe eine Ausbildung für Kulturmanagement
gemacht. Ich schrieb meine Diplomarbeit über Max von Oberleitner,
und der damalige Chef des Institutes für kulturelles Management
war nach meinem Aufnahmegespräch sehr begeistert, weil er Max von
Oberleitner in seinen Standardwerken beschrieben hat. Damit hat
er mir das Tor geöffnet, dort überhaupt aufgenommen zu werden.
Man hat mich dann ohne mein Wissen beim Tonkünstlerorchester, wo
eine Stelle vakant war, für ebendiese Stelle vorgeschlagen. Mein
Vorgänger, Dr. Danzinger, war für sechs Monate karenziert, was
später auf ein Jahr verlängerte wurde. In diesem Jahr wurden
sechs Personen ausprobiert. Da konnte ich mich wahrscheinlich am
besten präsentieren, denn mir wurde diese Stelle zugesprochen.
Ich wurde als Organisationsleiter angestellt. Prof. Pietsch, den
damaligen Direktor des Orchesters, erlebte ich als einen der
profundesten Literaturkenner. Er war mir Lehrer und Vorbild, denn
er war in seiner Zeit wirklich einer der tollsten Musikmanager.
Bisher habe ich noch niemanden getroffen, der seinem
Repertoirewissen nahe gekommen ist. Mit ihm habe ich die ersten
Jahre zusammengearbeitet und bin in der Folge 16 Jahre beim
Tonkünstlerorchester geblieben.
Mag. Lehner:
Ich habe eine Ausbildung für Kulturmanagement
gemacht. Ich schrieb meine Diplomarbeit über Max von Oberleitner,
und der damalige Chef des Institutes für kulturelles Management
war nach meinem Aufnahmegespräch sehr begeistert, weil er Max von
Oberleitner in seinen Standardwerken beschrieben hat. Damit hat
er mir das Tor geöffnet, dort überhaupt aufgenommen zu werden.
Man hat mich dann ohne mein Wissen beim Tonkünstlerorchester, wo
eine Stelle vakant war, für ebendiese Stelle vorgeschlagen. Mein
Vorgänger, Dr. Danzinger, war für sechs Monate karenziert, was
später auf ein Jahr verlängerte wurde. In diesem Jahr wurden
sechs Personen ausprobiert. Da konnte ich mich wahrscheinlich am
besten präsentieren, denn mir wurde diese Stelle zugesprochen.
Ich wurde als Organisationsleiter angestellt. Prof. Pietsch, den
damaligen Direktor des Orchesters, erlebte ich als einen der
profundesten Literaturkenner. Er war mir Lehrer und Vorbild, denn
er war in seiner Zeit wirklich einer der tollsten Musikmanager.
Bisher habe ich noch niemanden getroffen, der seinem
Repertoirewissen nahe gekommen ist. Mit ihm habe ich die ersten
Jahre zusammengearbeitet und bin in der Folge 16 Jahre beim
Tonkünstlerorchester geblieben.
Danach habe ich an der Columbia University noch ein Studium den Master of Science absolviert. Anschließend wurde ich zu den Wiener Symphonikern geholt, wo ich jetzt die Geschäftsführung innehabe.
AMN: Nach einem Jahr kann man schon Bilanz ziehen konnten Sie bereits eigene Konzepte entwickeln und durchsetzen, oder ist man im ersten Jahr noch gezwungen, vorgegebene Verträge abzuarbeiten?
Mag. Lehner: Ich habe das Glück gehabt schon Vorarbeiten machen zu können, sodass bereits in meiner ersten Saison die Handschrift meines Teams zum Tragen kommen konnte. Ich glaube, wir konnten hier gemeinsam schon viel erreichen. Wir konnten die Wiener Symphoniker noch stärker in das Kulturgeschehen der Stadt Wien verankern. Wir hatten schöne Auslandstourneen etwa Ljubljana, Zagreb und Budapest mit Fabio Luisi und Lang Lang - und wollen in diesem neuen Europa auch einen wesentlichen musikalischen, kulturellen Beitrag für die Musikstadt Wien leisten. Wir hatten ein enorm gutes Feedback beim lokalen Publikum, sichtbar durch ausverkaufte Veranstaltungen.
Das Orchester ist viel stärker ausgelastet d.h. wir haben um 22% mehr Auftritte, was in einer Zeit, wo es den Menschen gut geht, nicht immer gegeben erscheint. Es ist leider ein Phänomen, dass in solchen Zeiten des Wohlstandes gerade die Kulturförderung zurückgeht. Es ist uns daher ein Bedürfnis, als Wiener Symphoniker den Stellenwert Wiens als Musikstadt weiterhin zu bewahren.
AMN: Musik bedeutet Ihnen sicher sehr viel. Legt man als ein in der Kultur Tätiger andere Wertmaßstäbe an? - Wo würden Sie den Hebel ansetzen um den Ruf Wien eine Musikstadt auch weiterhin zu gewährleisten?
Mag. Lehner: Wenn in dieser Zeit im Radio, Fernsehen und in den Zeitungen nur über Fußball berichtet wird, dann ist mir bewusst, dass wir noch sehr, sehr viel unternehmen müssen, um auch Musik und Kultur stärker in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Ich glaube, hier sollte der Ansatz schon in den Familien beginnen und in den Schulen weiter geführt werden. Es ist leider kein Selbstverständnis, dass hier gesungen, musiziert oder getanzt wird. Wie soll dann ein junger Mensch Zugang dazu finden? Wir machen Projekte für Kinder, wir gehen auch hinaus in die Breite, z.B. zum Donauinselfest. Es ist sicher nicht das Publikum, das dann in den Musikverein oder das Konzerthaus kommt, um ein Abonnement zu kaufen als Bewusstseinsbildung ist es aber unerlässlich, auch hier aktiv zu werden. Es soll Freude und positive Stimmung erzeugen und verinnerlichtes musikalisches Erleben vermitteln. Musik ist aus unserem und überhaupt aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken. Jeder Anlass hat seine Musik, und die Symbolkraft einer Landeshymne eint ein Volk. Und wenn z.B. der Donauwalzer als geheime Hymne Österreichs bezeichnet wird, so ist auch hier eine emotionale Übereinstimmung feststellbar, die weithin ausstrahlt und ein Heimatgefühl vermittelt. Das ist eine unserer großen Aufgaben, die wir uns gestellt haben und zu der wir uns bekennen, um den Verflachungen der Fastfood-Kultur entgegen treten zu können.
AMN: Spielen Sie selbst ein Musikinstrument? Konzertbesuche sind natürlich von Berufswegen eine Pflicht. Kann man in Ihrem Fall abschalten und ein Konzert nur genießen, oder sind Sie dabei immer in der Situation zu vergleichen, abzuwiegen. Was könnte man verbessern, wo liegen die Fehler, (nicht nur im musikalischen Sinn), was kommt beim Publikum an, wie ist die Präsentation usw.?
Mag. Lehner: Ich spiele derzeit kein Instrument, habe einmal Gitarre gelernt, aber ich singe, wenn auch nicht professionell, jedoch sehr gerne. Menschen die singen, kommen sicher auch besser mit dem Erlernen eines Instruments zurecht. Ich war zu faul, da ich es in einem Alter, lernte wo man sich von zu vielen anderen Interessen ablenken lässt. Leider - was Konzerte betrifft - kann ich nicht nur das Konzert genießen, man erwartet von mir auch hier, Stellung zu nehmen. Kritische Anmerkungen zu geben stehen einem dabei etwas im Wege, es gibt jedoch viele Momente, in denen man die wunderbaren und tollen Ausdrucksmöglichkeiten musikalischer Werke und Interpretationen erleben darf. Ich erinnere mich, wenn ich vor 20 Jahren noch Probleme hatte, eine Bruckner-Symphonie zu hören, dann empfinde ich diese heute als reines Repertoirewerk. Mein musikalisches Spektrum hat sich im Laufe meiner Tätigkeit im Musikmanagement so erweitert, dass ich selbst noch nicht abschätzen kann, wo das Ende der Entwicklung ist.
AMN: Die Wiener Symphoniker sind in Bregenz das Festspielorchester. Da gibt es für Sie vom Organisatorischen her ein intensives Planen. Haben Sie und Ihr Team besondere Strategien für diese aufwendige Arbeit entwickelt um, alles gut über bzw. auf die Bühne zu bringen?
Mag. Lehner: Für die Bregenzer Festspiele übersiedelt unser Büro für 6 Wochen nach Bregenz, und in Zusammenarbeit mit den dortigen Veranstaltern haben wir ein perfekt funktionierendes Team. Wir haben 25 Opernaufführungen am See, und es kommen noch viele Konzerte dazu. Es ist eine äußerst intensive Zeit, in der sehr viel produziert wird und daher ein langfristiges Planen mit großem Know-how gefragt ist. Das funktioniert dank meines gut eingespielten Teams sehr gut, und ich kann mich darauf verlassen.
AMN: Es sind nicht nur Festspiele, die eine Herausforderung an alle stellen. Konzertreisen sind wahrscheinlich eine noch größere Belastung für das Orchester und die Organisation, sind doch in diesem Fall auch die finanziellen Abwicklungen besonderen Kriterien unterworfen. Können Sie für die nächste oder übernächste Saison schon einige Konzertreisen ankündigen?
Mag. Lehner: Für die nächste Saison ist eine große Japan-Tournee und eine China-Reise geplant. Dazu kommen relativ viele Abstecher, die oft nicht länger als 24 Stunden sind wir fliegen oder fahren in eine Stadt, spielen ein Konzert und fahren sofort wieder zurück. Das hat natürlich auch ökonomische Gründe, da längere Aufenthalte Hotelkosten bedingen. Zusätzlich sind wir noch im Theater an der Wien eingesetzt. Das alles ist eine große Herausforderung an die Planung und sowohl auch an die Musiker. Unser Orchester ist jedoch so professionell und gut, um auch bei solchen Strapazen höchste Qualität bieten zu können.
AMN: Herr Mag. Lehner, wir sind alle überzeugt, dass Musik und Kultur nicht nur für Österreich es sollte für alle Länder und Kulturen gelten einen besonderen Stellenwert hat. Glauben Sie, ist dieser Umstand auch allen unseren Mitmenschen, vor allem aber den wesentlichen politischen Entscheidungsträgern bewusst? Wenn nicht, wie könnte man hier größeres Interesse und konstruktives Mitverantworten für die Erhaltung und Förderung dieses wertvollen Gutes stärker publik machen?
Mag. Lehner: Meiner Meinung nach ist es unsere Aufgabe, sehr laut zu schreien, um als Kulturträger wahrgenommen zu werden. Es ist mir auch bewusst, dass Politiker oft zu entscheiden haben über die Notwendigkeit eines sagen wir Spitalbaues oder die Erhaltung einer Kultureinrichtung. Hier stellt sich die Frage, die ich eingangs gestellt habe warum hat eine Gesellschaft, der es gut geht, Schwierigkeiten, Kultur in ausreichendem Maße zu fördern? Man darf mich da nicht falsch verstehen weil eine Demokratisierung (bei vollstem Demokratieverständnis) zur Verflachung des Kulturverständnisses führen kann und Politiker in erster Linie dem Mehrheitsanspruch gerecht werden müssen (wollen?).
Das ist der Ansatzpunkt hier muss immer wieder in eindrucksvoller Weise der Wert der Kunst hervorgehoben werden, um das geistige und das humane Zusammenleben, das den Menschen zum Menschen macht, bewusst zu machen. Nur so kann ein Miteinander mit gemeinsamer Zielsetzung erreicht werden, in der das Materielle mit dem Kulturellen in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt wird.
So wie ein Orchester von einem Dirigenten zusammengehalten wird und gemeinsam dem Publikum ein musikalisches Erleben ermöglicht, verhält es sich auch für die große Gesellschaft es kann nicht jeder gegen jeden sein. Es gibt Werte, die nicht quantitativ, sondern qualitativ bestimmt sind. Das ist auch die Aufgabe eines Musikmanagers, die Stimme zu erheben, um dieses Gleichgewicht in der Gesellschaft zwischen Materiellem und Ideellem publik zu machen.
AMN: Seit heuer haben die Wiener Symphoniker einen neuen Chefdirigenten. Fabio Luisi, der uns allen bestens bekannt ist. Erwarten Sie sich davon eine Änderung in der Programmgestaltung, und glauben Sie, kann sich auch das Klangbild bzw. der Klangcharakter des Orchesters dadurch ändern?
Mag. Lehner: Fabio Luisi ist ein wunderbarer Orchestererzieher. Er macht genau das Richtige. Er nimmt das, was da ist und lässt das Spezifische, das jedem Orchester eigen ist, bestehen. Er arbeitet mit dem individuellen Klangcharakter, ohne diesen gewaltsam verändern zu wollen, präzisiert seine Vorstellungen genau und erfreut sich an deren Umsetzung. Luisi weiß, dass man das Eigenleben eines Klangkörpers nicht durch extreme Änderungen beeinflussen darf, ohne das harmonische Gefüge in Unordnung zu bringen. Ich glaube, das zeichnet Fabio Luisi als Chefdirigenten der Wiener Symphoniker aus, da das Orchester von sich selbst aus schon ein Qualitätsfaktor ist, dem er durch seine Musizierweise und Interpretation Zusammenhalt und stärkere Strahlkraft vermitteln kann. Luisi wird weiterhin die Bruckner-Mahler Linie weiterführen und dazu auch Schwerpunkte mit der Romantik setzen.
AMN: Zum Musikstudium in Österreich - auch wenn Sie hier keinen Einfluss nehmen können die Meinungsvielfalt ist jedoch wichtig. Es geht um die Frage: Bieten wir unserer Jugend die größtmöglichen Chancen? Werden die Grundausbildungsstrukturen so gehandhabt, dass Chancengleichheit auch beim Beginn eines Musikstudiums in Österreich für alle gegeben ist?
Mag. Lehner: Das Musikstudium in Österreich ist ein sehr heißes Thema. Was wollen wir? Wollen wir eine Grundausbildung, die in die Breite wirkt? Wollen wir nur Spezialisten? In beiden Fällen muss man sehr früh mit der musikalischen Erziehung beginnen. Angefangen bei der Familie über die Kindergärten bis zur Schule sollte eine früh beginnende Interessenlage geweckt werden. Nur so kann man talentierte Kinder finden, deren Anlagen sonst nie zutage gekommen wären. Wie weit sich diese Talente dann für eine Ausbildung zum Musiker entscheiden ist ein persönliches Anliegen der Kinder und deren Eltern. Ob sich aus dem vorhandenen Talent eine große Karriere entwickelt, hängt von vielen anderen Faktoren ab. Dass wir in Wien eine gewisse Tradition die Wiener Schule haben - sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden. Man sollte daher junge Musiker, die hier ihre Wurzeln haben, auch die entsprechende Förderung angedeihen lassen und einer globalen Ausbildung in dieser Tradition ermöglichen.
AMN: Wenn Sie, Herr Mag. Lehner, einen Wunsch oder eine Vision einbringen könnten, was würden Sie an dieser Stelle vorbringen?
Mag. Lehner: Für die Wiener Symphoniker würde ich mir wünschen, dass wir viele Jahre weiterhin diesen Status behalten und die Anerkennung bekommen, für die wir hart arbeiten. Wir arbeiten heuer mit einem Symposion zusammen, bei dem Frau Dr. Berka-Schmidt einen wunderbaren Satz sagte: Ein Orchester müsste zu einem Drittel vom Sozialministerium, zu einem Drittel vom Gesundheitsministerium und zu einem Drittel vom Kulturministerium bezahlt werden. Vielleicht wird das einmal zum Wohle aller beherzigt?
AMN: Wir danken herzlich für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen Ihrer nächsten Projekte und die Erfüllung Ihrer Wünsche.
